Genetische Ursachen der Polymyxin-Resistenz
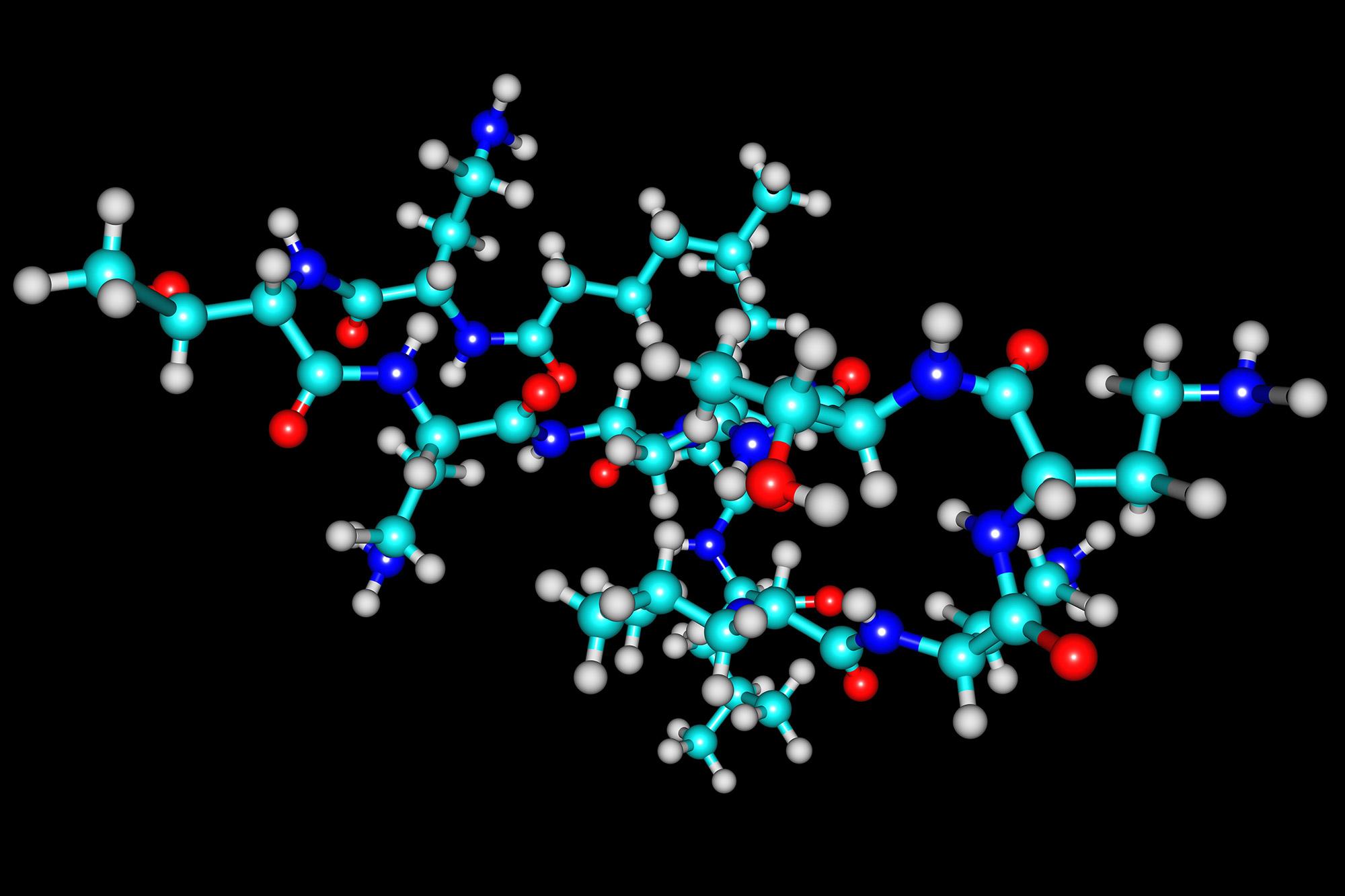
Forschende haben ein neuartiges Gen identifiziert, das eine Resistenz gegen Polymyxin bewirkt. Zudem konnten sie aufzeigen, welche Mechanismen die Expression dieses Gens in Bakterien beeinflussen.
Porträt/Projektbeschrieb (abgeschlossenes Forschungsprojekt)
Polymyxine dienen in der Humanmedizin als letzte Behandlungsmöglichkeit, wenn andere Präparate versagen («Reserve»-Antibiotikum), und kommen auch in der Veterinärmedizin häufig zur Anwendung. Inzwischen sind immer mehr Erreger resistent gegen Polymyxine, insbesondere Bakterien der Arten Escherichia coli und Klebsiella pneumoniae. Dieser Trend ist sowohl in der Human- als auch in der Veterinärmedizin zu beobachten. Eine Forschungsgruppe an der Universität Fribourg hat nun die Prozesse analysiert, die zur Entwicklung und Ausbreitung von Polymyxinresistenzen beitragen. Dazu untersuchte sie bei verschiedenen Bakterienarten, welche genregulatorischen Prozesse eine Resistenz herbeiführen. Die Forschenden wollten damit auch die Grundlage für eine Vergleichsanalyse von antibiotikaresistenten Bakterien aus Menschen, Tieren und Umwelt schaffen. Diese sollte Aufschluss darüber geben, ob wesentliche Verbindungen zwischen diesen Bereichen bestehen und wie sich diese unterbrechen lassen, damit die Entwicklung und Verbreitung von Resistenzeigenschaften eingedämmt werden kann.
Neu entdeckte genetische Ursache der Resistenz
In ihrer Studie hat die Forschungsgruppe ein neuartiges Gen identifiziert, das bewirkt, dass Bakterien weniger empfindlich gegenüber Polymyxinen werden. Inzwischen ist bekannt, dass sich dieses Gen weltweit verbreitet hat. Die Forschenden konnten die Mechanismen aufzeigen, mit denen die Expression dieses Gens in Bakterien beeinflusst wird. Demnach wird die Genexpression und damit die Resistenz gegen das Polymyxin Colistin ausgelöst, wenn die Bakterien mit suboptimalen Mengen des Antibiotikums in Kontakt kommen und dabei nicht abgetötet werden. Dies bedeutet, dass die Anwendungsweise des Antibiotikums einen direkten Einfluss auf die Entwicklung der vorhandenen Resistenzen hat. Die Forschenden konnten auch nachweisen, dass sich umgekehrt bei einem Verzicht auf dieses spezifische Antibiotikum die Situation wieder entspannen kann: Konkret beobachteten sie bei mehreren Landwirtschaftsbetrieben, dass hohe Mengen an zuvor vorhandenen problematischen colistinresistenten Escherichia-coli-Zellen wieder auf ein sehr niedriges Niveau zurückgingen, wenn vollständig auf den Einsatz von Colistin verzichtet wurde.
Kein direkter Zusammenhang zwischen Resistenzen bei Menschen und Tieren
Zur Beantwortung der Frage, ob spezifische Resistenzen zwischen Erregern in Tieren und solchen in Menschen weitergegeben werden, haben die Forschenden zahlreiche Proben von polymyxinresistenten Enterobakterien auf das neu entdeckte Gen hin untersucht und verglichen. Mit speziell entwickelten Diagnosetests analysierten sie Proben aus der Umwelt, aus Lebensmitteln, aus Tieren und aus Menschen in der Schweiz, Frankreich, Portugal, Ägypten und anderen Ländern. Die erzielten Ergebnisse zeigten keinen klaren direkten Zusammenhang zwischen dem in der Veterinärmedizin beobachteten Selektionsdruck durch Colistin und dem Auftreten von Enterobakterien mit Colistinresistenz beim Menschen. Solche Korrelationen werden jedoch bei verschiedenen Bakterienarten vermutet. Deshalb empfehlen die Forschenden, andere Bakterienarten mit den neu entwickelten diagnostischen Tests auf diese spezifische Resistenz zu untersuchen.
März 2023
Originaltitel
Dynamics of transmission of polymyxin resistance genes in Enterobacteriaceae; from the environmental source to the patient
